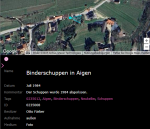Verlagerung "Rosmarin" in Furth-Aigen
Wie ich anlässlich einer kleinen Herbstwanderung rund um den Göttweiger Berg feststellte, sind 2 Bauobjekte die 1944 für die U-Verlagerung "Rosmarin" im Ortsteil Aigen der Marktgemeinde Furth errichtet wurden, verschwunden. Es handelt sich dabei um ehemalige Bürobaracken aus Betonfertigteilen.
Lt. Verlagerungsliste der SDP-Nibelungenwerke waren im Kellersystem der U-Verlagerung „Rosmarin“ auf 1.200 m² Fläche 150 Personen (Großteils Kriegsgefangene aus dem Lager Stalag XVII B – Krems-Gneixendorf) mit der Herstellung von Laufwerksteilen für Panzer IV beschäftigt.
In der benachbarten U-Verlagerung „Reseda“ im „Göttweiger Stiftskeller“ beim Kirchenplatz in Furth waren es 300 Personen auf 2.000 m² Verlagerungsfläche. Die „Verlagerungsdaten“ stammen aus
Karl-Heinz Rauscher; „Steyr im Nationalsozialismus – Industrielle Strukturen“; S. 179.
Bilder Teil 1 – zeigen die ehemaligen Baracken:
Die nachfolgenden Fotos stammen aus 2000 und 2001 und zeigen jeweils in der Bildmitte die beiden Baracken aus Betonfertigteilen. Die Aufnahmestandpunkte für die gezoomten Bilder 1. – 4. waren oberhalb der Bahnstrecke Krems-Herzogenburg und für 5 u. 6 die Aussichtsterrasse des Stiftes Göttweig. Gut zu erkennen ist auch die Geländestufe zwischen den Baracken im Fladnitztal und den höher gelegenen Eingangsbauwerken zu den Kelleranlagen in der Lösswand.
Wie ich anlässlich einer kleinen Herbstwanderung rund um den Göttweiger Berg feststellte, sind 2 Bauobjekte die 1944 für die U-Verlagerung "Rosmarin" im Ortsteil Aigen der Marktgemeinde Furth errichtet wurden, verschwunden. Es handelt sich dabei um ehemalige Bürobaracken aus Betonfertigteilen.
Lt. Verlagerungsliste der SDP-Nibelungenwerke waren im Kellersystem der U-Verlagerung „Rosmarin“ auf 1.200 m² Fläche 150 Personen (Großteils Kriegsgefangene aus dem Lager Stalag XVII B – Krems-Gneixendorf) mit der Herstellung von Laufwerksteilen für Panzer IV beschäftigt.
In der benachbarten U-Verlagerung „Reseda“ im „Göttweiger Stiftskeller“ beim Kirchenplatz in Furth waren es 300 Personen auf 2.000 m² Verlagerungsfläche. Die „Verlagerungsdaten“ stammen aus
Karl-Heinz Rauscher; „Steyr im Nationalsozialismus – Industrielle Strukturen“; S. 179.
Bilder Teil 1 – zeigen die ehemaligen Baracken:
Die nachfolgenden Fotos stammen aus 2000 und 2001 und zeigen jeweils in der Bildmitte die beiden Baracken aus Betonfertigteilen. Die Aufnahmestandpunkte für die gezoomten Bilder 1. – 4. waren oberhalb der Bahnstrecke Krems-Herzogenburg und für 5 u. 6 die Aussichtsterrasse des Stiftes Göttweig. Gut zu erkennen ist auch die Geländestufe zwischen den Baracken im Fladnitztal und den höher gelegenen Eingangsbauwerken zu den Kelleranlagen in der Lösswand.
Anhänge
-
333 KB Aufrufe: 155
-
240,3 KB Aufrufe: 144
-
251,5 KB Aufrufe: 147
-
243,1 KB Aufrufe: 149
-
305 KB Aufrufe: 149
-
282,8 KB Aufrufe: 144
Zuletzt bearbeitet: